Dran bleiben!
News von restruct.law
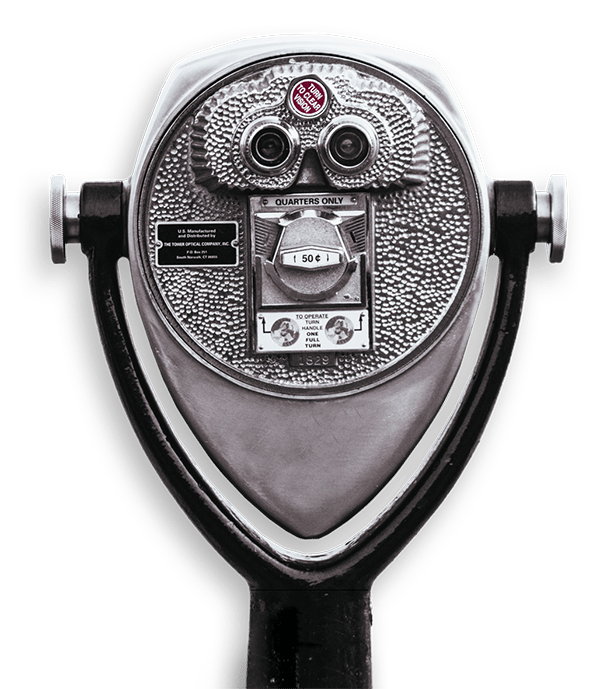
Themen
Insolvenzantrag: wie finde ich das richtige Insolvenzgericht?
Insolvenzantrag: wie finde ich das richtige Insolvenzgericht?
Wenn ein Insolvenzantrag erforderlich wird, muss geklärt werden, bei welchem Insolvenzgericht der Antrag gestellt wird.
Die Frage nach dem richtigen, örtlich zuständigen Insolvenzgericht ist nicht immer leicht zu beantworten. und schnell entwickelt sich daraus eine Stolperfalle beim Insolvenzantrag. Insolvenzverfahren werden an den Amtsgerichten geführt. Sie sind dafür zuständig (§ 2 InsO). , da die Bundesländer von den Ausnahmeregelungen in § 3 Abs. 2 InsO nach wie vor reichlich Gebrauch machen. Unter diesem Link kann das zuständige Insolvenzgericht schnell und unproblematisch ermittelt werden. Ort oder Postleitzahl des Sitzes des Antragstellers eintragen und schon gibt es deutschlandweit die passende Auskunft. Leider sind die Restrukturierungsgerichte nach dem StaRUG hier nicht zu ermitteln.
Hat die Gesellschaft den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit an einem anderen Ort als ihrem Sitz, so ist ausschließlich das Insolvenzgericht zuständig, in dessen Bezirk diese wirtschaftliche Tätigkeit liegt (§ 3 I S. 2 InsO).
Ein Insolvenzantrag bei einem unzuständigen Insolvenzgericht, wird von diesem Gericht wegen Unzulässigkeit zurückgewiesen. Zuvor erhält der Antragsteller einen Hinweis und hat die Möglichkeit, eine Verweisung an das zutreffende Insolvenzgericht zu beantragen (§ 4 InsO iVm § 281Abs. 1 ZPO). Selbständig (von Amts wegen) verweist das unzuständige Gericht den Antrag nicht. Jedoch muss das angerufene Gericht bei unklarer Sachlage zunächst selbst alle Umstände ermitteln, die für das Insolvenzverfahren von Bedeutung sind. Das gilt auch für die Zuständigkeitsvoraussetzungen. Für diese Ermittlungen kann das angerufene Gericht einen Sachverständigen einsetzen.
Der Antrag bei einem unzuständigen Gericht ist ein unzulässiger Insolvenzantrag. Er erfüllt nicht die gesetzliche Insolvenzantragspflicht. Insoweit sind auch damit verbundene Haftungsansprüche und strafrechtliche Konsequenzen des Geschäftsführers nicht erledigt.
Unwissenheit schützt nicht vor Strafe und Haftung!
Verfügt ein Geschäftsführer nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse, die zur Prüfung einer Insolvenzantragspflicht erforderlich sind, hat er sich hierzu unverzüglich beraten zu lassen. Dazu ist eine fachlich qualifizierte Person (Rechtsanwalt, qualifizierte Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) auszuwählen. Für die Beratung sind die Verhältnisse der Gesellschaft und die dazu erforderlichen Unterlagen umfassend offenzulegen. Sodann muss der Geschäftsführer auch auf eine unverzügliche Vorlage des Prüfergebnisses hinwirken (BGH - 27.03.2012 - II ZR 171/10).
Podcast: Insolvenzrecht für die Ohren
Mehr zum Insolvenzantrag und zur Insolvenzantragspflicht gibt es in unserer Podcastfolge „Wer jetzt verschleppt, wird härter rangenommen“.
#38 mit Ethikerin Prof. Dr. Alena Buyx
#38 mit Ethikerin Prof. Dr. Alena Buyx
Zum Jahresauftakt 2023 haben wir Prof. Dr. Alena Buyx an unser Mikrofon eingeladen. Die Medizinethikerin an der TU München und Vorsitzende des deutschen Ethikrates hat in den letzten Jahren vielfach zu den Themen Ethik, Moral und Krise Stellung genommen. Dabei lag der Kontext selbstverständlich im medizinischen Bereich.
Aber auch bei Krise, Insolvenz und Restrukturierung von Unternehmen geht es um die großen Fragen von Ethik und Moral. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um schlagzeilenträchtige Firmenzusammenbrüche wie Wirecard, Lehman Brothers oder FTX handelt oder um den Handwerksbetrieb um die Ecke.
Daher haben wir Alena gefragt, ob es eine Moral des Scheiterns gibt. Wie so oft gibt es keine einfache Antwort. Bei dem beiderseitigen Blick über den Tellerrand haben sich viele interessante Perspektiven ergeben. Wie gehen wir und unsere Gesellschaft mit einem Scheitern um? Prangern wir lieber an oder ebenen wir den Weg für eine 2. Chance? Wann sind Haltung und Verantwortung gefragt? Zu diesen und weiteren Fragen entwickelt sich ein spannendes Gespräch über griechische Mythen, fuck-up nights und die Auswirkungen multipler Anforderungen unserer Zeit.
Viel Spaß beim Hören! Danke Alena!
Lasst euch in den Äther saugen, eure Ohren werden Augen! Stay tuned!
restruct.law – Podcast zu Krise, Insolvenz und Restrukturierung von Unternehmen mit neuer Homepage
restruct.law – Podcast zu Krise, Insolvenz und Restrukturierung von Unternehmen mit neuer Homepage
Der meistgehörte Podcast der deutschen Restrukturierungsszene hat seinen Webauftritt zu Krise, Insolvenz und Restrukturierung von Unternehmen neu gestaltet. Unter www.restruct.law sind neben den einzelnen Folgen des Podcast ab sofort auch weitere Informationen zu den Themen Restrukturierung, Unternehmenssanierung und Insolvenz abrufbar.
Der Podcast restruct.law ist seit 3 Jahren regelmäßig zu hören und richtet sich an ein Fachpublikum. Die Restrukturierungsanwälte und Insolvenzverwalter Dr. Christian Heintze und Heiko Schaefer diskutieren in ihrem Podcast mit wechselnden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Themen reichen von der Haftung der Geschäftsführer, Problemen der Insolvenzanfechtung bis zu den neuesten Gesetzesentwicklungen bei einem Insolvenzantrag.
Auf Augenhöhe diskutieren die restrukturierungserfahrenen Anwälte mit Unternehmensberatern, anderen Anwälten, Investoren und Hochschullehrern zu den aktuellen Themen der deutschen Restrukturierungsbranche. Dabei geht es um Neuerungen wie das StaRUG, Erfahrungen mit Insolvenzverfahren bei Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren oder außergerichtliche Sanierungen.
Aber auch vermeintliche off-Topics werden mehr in den Fokus gerückt: warum nicht mal über die Moral beim Scheitern sprechen und neue Sichtweisen eröffnen? Denn Beweglichkeit im Kopf ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die erfolgreiche Bewältigung von Krisen.
Die letzten Monate zeigten einen neuen Trend: mehr Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte und Beiräte interessieren sich für den Podcast restruct.law. Der neue Web-Auftritt bietet daher mehr Basisinformationen, da das Interesse an den Themenschwerpunkten Krise, Insolvenz und Restrukturierung von Unternehmen kontinuierlich zunimmt.
Mehr über den Podcast rund um Krise, Insolvenz und Restrukturierung gibt es hier.
Lasst euch in den Äther saugen, eure Ohren werden Augen! Stay tuned!
#37 mit Rechtsanwältin Dr. Sabine Vorwerk
#37 mit Rechtsanwältin Dr. Sabine Vorwerk
Mit Rechtsanwältin Dr. Sabine Vorwerk, Partnerin der internationalen Kanzlei Linklaters, sprechen wir über die Rolle der Gesellschafter bei einer Unternehmensrestrukturierung. Einer ihrer Beratungsschwerpunkte ist die Beratung internationaler Gesellschafter in der Krise und Insolvenz deutscher Gesellschaften. Dabei wird Sie oft mit den unterschiedlichen Ansätzen insbesondere aus dem englichen und us-amerikanischen Rechtsraum konfrontiert.
Wir erfahren von ihr, wie sich Gesellschafter bei einer bestandsgefährdenden Krise verhalten. Aber welche Rolle ist den Gesellschaftern in Insolvenz, Krise und Restrukturierung in der Insolvenzordung und im StaRUG zugedacht? Wann können Gesellschafterdarlehen weiterhelfen? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Gesellschafter für ein aktives Krisenmanagement? Insbesondere diskutieren wir, ob die Gesellschafter durch gesetzliche Änderungen eine aktivere und vor allem abgesicherte Rolle bei einer Neufinanzierung erhalten sollten.
Viel Spaß beim Hören! Danke Sabine!
Lasst euch in den Äther saugen, eure Ohren werden Augen! Stay tuned!
#36 mit Rechtsanwalt Kolja von Bismarck
#36 mit Rechtsanwalt Kolja von Bismarck
Rechtsanwalt Kolja von Bismarck ist Restrukturierungsberater und Partner der internationalen Kanzlei Sidley Austin. Er war unser erster Gast und so haben wir ihn zur 3-Jahre-Jubiläumsfolge noch einmal eingeladen.
Es ist ein Rückblick auf ereignisreiche 36 Monate rund um Insolvenz, Krise und die Restrukturierung von Unternehmen. Wir erörtern mit Kolja DAS Hindernis bei StaRUG-Verfahren und die neuesten Änderungen der Insolvenzordnung. Aber wir haben nicht nur über die Vergangenheit gesprochen, sondern auch die zukünftigen Themenfelder bei Insolvenz, Krise und die Restrukturierung geschaut. Dabei wird die Überschuldung als Insolvenzantragsgrund ganz sicher weiterhin eine Rolle spielen. Sie spielt gerade in der krisennahen Beratung und als Auslöser von Insolvenzantragspflichten immer noch eine große Rolle - zu Recht? Aber auch über die Rolle der TMA Deutschland, in deren Vorstand er seit der Gründung tätig ist, haben wir gesprochen.
Auch über die Attraktivität des Restrukturierungsstandortes London haben wir diskutiert. Von Kolja erfahren wir außerdem, dass er schon lange dabei ist, die Welle mag, aber trotzdem nicht surfen geht.
Viel Spaß beim Hören! Danke Kolja!
Lasst euch in den Äther saugen, eure Ohren werden Augen! Stay tuned!
#35 mit Rechtsanwalt Daniel Fritz
#35 mit Rechtsanwalt Daniel Fritz
Es stehen die nächsten Änderungen der Regelungen zu Krise, Insolvenz und Restrukturierung von Unternehmen an. Die EU-Kommission arbeitet an einem neuen Richtlinienvorschlag zur Harmonisierung des Insolvenzrechts in Europa. Im Fokus werden diesmal Klein- und Kleinstunternehmen stehen. Was ist mit diesem Vorschlag zu erwarten? Rechtsanwalt Daniel Friedemann Fritz ist Partner der internationalen Kanzlei Dentons und engagiert sich seit vielen Jahren im internationalen und insbesondere europäischen Insolvenzrecht. Er wird als Experte in Brüssel gehört, wenn es Neuerungen geht. Daher kann er uns sehr genau Auskunft zu den Hintergründen des Richtlinienvorschlages geben: der Fokus wird auf der Gestaltung effektiver und kostengünstiger Insolvenzantrags- und Restrukturierungsmöglichkeiten liegen. Das und mehr in der neuen Folge von restruct.law - Der Restrukturierungspodcast.
Viel Spaß beim Hören! Danke Daniel!
Lasst euch in den Äther saugen, eure Ohren werden Augen! Stay tuned!